© Jacob Lund - stock.adobe.com

Unsere Fachkräftestrategie
Die dritte Fachkräftestrategie des Landes Rheinland-Pfalz für den Zeitraum 2022 bis 2026 knüpft an die vorhergehenden beiden Strategien (Laufzeiten 2014 bis 2018 und 2018 bis 2022) an. Da die Partner im Rahmen der vorangegangenen Strategien viele grundlegende Ziele und Vorhaben bereits erfolgreich zusammen bearbeitet haben, konnten sie diese in der neuen Strategie weiter schärfen. Die Zahl der Ziele ließ sich so auf insgesamt sieben komprimieren. Diese sind mit 62 konkreten, aufeinander abgestimmten Vorhaben hinterlegt worden.
Der zukünftige Fachkräftebedarf zieht sich quer durch alle Arbeitsfelder und Branchen. Die vorliegende Strategie ist daher weiterhin branchenübergreifend ausgerichtet und formuliert Ziele und Vorhaben, die den Herausforderungen einer sich transformierenden Arbeits- und Ausbildungswelt gerecht werden. Die Digitalisierung, der Umbau in Richtung des klimaneutralen Wirtschaftens, der demografische Wandel und die Erschließung wirtschaftlicher Zukunftsfelder sind dabei maßgebliche Faktoren und stellen als Querschnittsthemen sowohl Hintergrund als auch dynamisches Umfeld dar, in dem die Strategie ihre Wirkung entfalten wird.
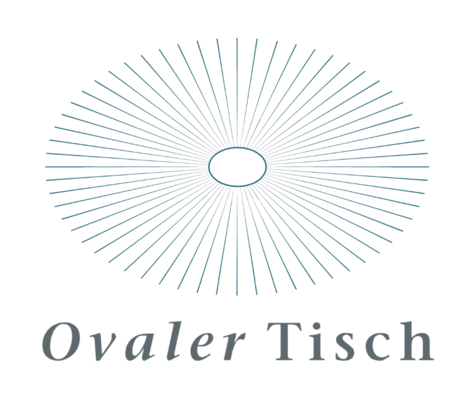
© Drazen - stock.adobe.com

Alle jungen Menschen haben Anspruch auf eine gute berufliche Orientierung, da diese ein entscheidender Erfolgsfaktor auf dem Weg ins Berufsleben ist. Mit ihrer Hilfe können sie eine Berufswahl treffen, die ihren Potentialen sowie Interessen entspricht und die zugleich die Gegebenheiten am Arbeitsmarkt berücksichtigt. Duale, schulische und akademische Bildungswege sind dabei gleichwertig.
Es gilt, junge Menschen auch über digitale Zugangswege anzusprechen. Zu einer praxisnahen und realitätsgetreuen Berufsorientierung gehören insbesondere vielfältige praktische Erfahrungen und außerschulische Angebote. Verstärkt begleitet werden sollen zudem junge Menschen, die besondere Unterstützung bei der Berufswahl benötigen. Um Parallelstrukturen zu vermeiden, müssen die Angebote der beruflichen Orientierung noch stärker systematisiert, gebündelt und miteinander verzahnt werden.
Die Übergänge zwischen Schule, Ausbildung und Studium sind fließend. Daher verstehen die Partner die nachfolgenden Einzelziele als ineinandergreifende Bausteine und berücksichtigen dies auch bei deren Umsetzung.
© Look! - stock.adobe.com

Der Übergang von der Schule in den Beruf stellt für junge Menschen eine wichtige Umbruchphase in ihrem Leben dar. Dieser Übergang sollte möglichst erfolgreich verlaufen – die Grundsteine dafür werden bereits in der Schule gelegt. Insbesondere die Zahl der jungen Menschen ohne Schulabschluss muss nach Ansicht der Partner weiter gesenkt werden. Alle Schülerinnen und Schüler sollen die notwendigen Voraussetzungen für eine erfolgreiche Berufsqualifizierung erlangen. Zudem gilt es, noch mehr Hilfe zum späteren Erwerb von Schulabschlüssen anzubieten und insbesondere die Möglichkeiten zur Erlangung von Schulabschlüssen über den beruflichen Bildungsweg bekannter zu machen.
Für junge Menschen mit besonderem Unterstützungsbedarf im Übergang sollen die Jugendberufsagenturen zu zentralen Anlaufstellen werden. Dabei ist durch frühzeitige und enge Zusammenarbeit mit den Schulen sicherzustellen, dass junge Menschen mit unzureichender Anschlussperspektive nicht verloren gehen. Hierfür bedarf es eines Datenaustauschs und der Vernetzung aller beteiligter Akteure. Diese jungen Menschen sollen durch betriebsnahe und zielgerichtete Angebote möglichst rasch an eine erfolgsversprechende Ausbildung herangeführt und bei Bedarf weiterhin begleitet werden. Auch um die Qualität des Übergangsbereichs weiter zu steigern, bedarf es möglichst lückenloser Informationen über Bildungsverläufe, die Hinweise auf neue Erfordernisse beim Unterstützungsbedarf geben.
© StockPhotoPro - stock.adobe.com

Die duale Ausbildung ist für junge Menschen unabhängig von ihrer individuellen Ausgangssituation ein Einstieg in eine sichere berufliche Zukunftsperspektive. Gleichzeitig ist sie für viele Unternehmen der Hauptweg zur Sicherung der eigenen Fachkräftebedarfe. Daher ist es ein Ziel dieser Fachkräftestrategie, die duale Berufsausbildung weiterhin zukunftsfest und attraktiv zu gestalten und die Aufstiegsmöglichkeiten transparenter zu kommunizieren. Hierfür sind Angebot und Nachfrage auf den vorrangig regionalen Ausbildungsmärkten noch besser aufeinander abzustimmen, alle Formen der dualen Ausbildung, vor allem Teilzeit- und Verbundausbildung, zu nutzen und in die Stabilität von Ausbildungsverhältnissen zu investieren. Dies ist vor allem in diesem Bildungsbereich nur durch abgestimmtes Handeln verschiedener Partner realisierbar.
Ein dauerhaft qualitativ hohes Niveau des dualen Ausbildungssystems an allen Lernorten ist ein Ziel dieser Fachkräftestrategie, um die Attraktivität dieses Bildungswegs im Wettbewerb mit anderen Bildungsbereichen sicherzustellen. Hierfür ist es erforderlich, dass sowohl ausbildende Betriebe als auch Ausbildungspersonal sowie Berufsschullehrkräfte durchgängig gute Voraussetzungen mitbringen und ausbauen. Ihre Leistungen wertzuschätzen ist ein Teil der authentischen Darstellung der Qualitäten und Chancen der dualen Berufsausbildung. Gleichzeitig müssen alle Lernorte der dualen Ausbildung qualitativ hochwertig und zukunftsorientiert ausgestattet sein.
© goodluz - stock.adobe.com

Angesichts technologischer und demografischer Transformationen kommt der berufsbezogenen Fort- und Weiterbildung besondere Bedeutung in der Fachkräftesicherung zu. Eine Kultur der kontinuierlichen Qualifizierung ist sowohl für die individuelle berufliche Perspektive über die gesamte Zeit der Erwerbstätigkeit hinweg als auch für den Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen wichtig. Hierfür gilt es, insbesondere auf Bundesebene geregelte Berufsbilder permanent weiter zu entwickeln und damit zukunftsfähig zu erhalten.
Ziel dieser Fachkräftestrategie ist es, dass Weiterbildung sowohl bei allen Erwerbspersonen als auch Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern als selbstverständlicher und lebensbegleitender Teil der Arbeitswelt angesehen wird. Es soll sichergestellt werden, dass die notwendigen finanziellen und zeitlichen Ressourcen für eine bedarfsgerechte Weiterbildung zur Verfügung stehen und die Weiterbildungsbereitschaft der Beschäftigten noch weiter gestärkt wird. Zudem bedarf es größtmöglicher Transparenz über Weiterbildungsangebote und Beratungsmöglichkeiten. Diese sollen auf die bestehenden Angebote auf Bundesebene abgestimmt werden.
Es sind zielgruppenspezifisch die Anpassungs- und Aufstiegsqualifizierung sowie die berufliche Neuorientierung und die abschlussorientierte Nachqualifizierung in den Blick zu nehmen. Zugleich ist zu berücksichtigen, dass Weiterbildung in Teilen betriebsintern sowie informell stattfindet.
© pressmaster - stock.adobe.com

Eine höhere Erwerbsbeteiligung von Frauen ist ein wesentlicher Hebel zur Fachkräftesicherung. Daher ist die Chancengleichheit am Arbeitsmarkt als durchgängiges Ziel zu verfolgen.
Trotz verbesserter Rahmenbedingungen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf kann von einer gleichberechtigten Teilhabe der Geschlechter am Arbeitsmarkt noch nicht gesprochen werden. Die Wahl von Berufen und Lebensentwürfen wird unter anderem von Rollenstereotypen beeinflusst. Ziel ist es, Frauen auch für Berufe zu gewinnen, in denen sie unterrepräsentiert sind und die oftmals überdurchschnittlich gut entlohnt werden.
Es gilt darüber hinaus, Rahmenbedingungen zu schaffen, durch die unfreiwillige Teilzeitbeschäftigung vermieden werden kann. Ein wesentlicher Hebel ist der Ausbau der Betreuungsangebote in Kitas, Kindertagespflege und Pflegeeinrichtungen.
Frauen unterbrechen ihr Erwerbsleben familienbedingt noch immer häufiger als Männer. Dies kann in Abhängigkeit von der Unterbrechungsdauer neben dem Erwerb neuer Kompetenzen auch mit dem Verlust von Berufsqualifikationen einhergehen. Die individuellen Chancen am Arbeitsmarkt können durch frühzeitige Weiterqualifizierungen verbessert werden.
© peopleimages.com - stock.adobe.com

Über die Erschließung inländischer Potentiale hinaus bedarf es zur Sicherung der Fachkräftebedarfe in Rheinland-Pfalz auch der Zuwanderung von im Ausland lebenden Fachkräften sowie an einer Ausbildung interessierten jungen Menschen. Um sie im Wettbewerb mit anderen Bundesländern für Rheinland-Pfalz zu gewinnen, gilt es, besondere Anstrengungen zu unternehmen.
Viele Menschen mit Migrationshintergrund sind heute schon in Rheinland-Pfalz als Fachkräfte tätig. Haben sie ihre Berufsqualifizierung außerhalb Deutschlands absolviert, stehen Instrumente wie die Kompetenz- oder Berufsqualifikationsfeststellung sowie die Anpassungsqualifizierung zur Verfügung, damit sie als Fachkräfte auf dem Arbeitsmarkt anerkannt werden bzw. arbeiten können. Ein Ziel dieser Fachkräftestrategie ist es, die Nutzung der Instrumente auch durch Prozesstransparenz zu erhöhen und den Zugang zu Sprachförderung zu erleichtern sowie die berufsbezogenen Sprachkompetenzen bedarfsgerecht zu fördern.
Für beide Gruppen eine Willkommenskultur mit attraktiven Unterstützungsangeboten zu entwickeln bzw. fortzuentwickeln, ist ein Ziel dieser Fachkräftestrategie ebenso wie eine stringente und authentische Werbung für Rheinland-Pfalz als Lebens- und Arbeitsort.
© NDABCREATIVITY - stock.adobe.com

Gute Arbeitsbedingungen sind wichtig, um die Fachkräftepotentiale nutzen zu können. Für Unternehmen und Beschäftigte schaffen Tarifverträge, Mitbestimmung, Weiterbildung und der Arbeits- und Gesundheitsschutz eine gute Basis.
Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels ist sowohl für Unternehmen als auch für Beschäftigte der Erhalt der Arbeitskraft bis zum gesetzlichen Renteneintrittsalter wichtig. Insbesondere mit Blick auf das frühzeitige Erkennen und Angehen von psychischen Belastungen am Arbeitsplatz sind ein starker Fokus auf die Gefährdungsbeurteilung sowie ein gutes betriebliches Gesundheitsmanagement nötig. Ziele sind daher, den Fokus auf Gefährdungsbeurteilungen und ein gutes betriebliches Gesundheitsmanagement über alle Betriebsgrößen hinweg zu legen sowie Gute Arbeit zum Standortfaktor in Rheinland-Pfalz werden zu lassen.
Um alle Fachkräftepotentiale erschließen und erhalten zu können, bedarf es einer hohen Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben. Gerade Erwerbstätige mit familiären Betreuungsverpflichtungen stehen hier vor besonderen Herausforderungen. Deshalb gilt es, die Angebote für Kinderbetreuung und Pflege auszubauen und bedarfsgerecht auszugestalten.